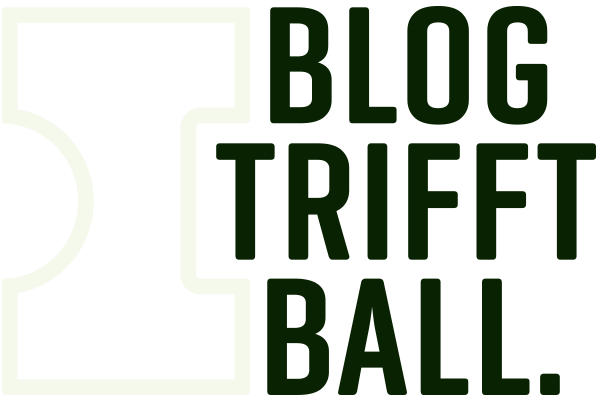Ole Hengelbrock:„Wir sind keine Märtyrer“
Notstand, Quarantäne, Reisebeschränkung: Es ist die schlimmste Ebola-Epidemie in der Geschichte Westafrikas. Das Auswärtige Amt hat längst alle Deutschen, die nicht im humanitären Dienst sind, aufgefordert, das Land zu verlassen. Ole Hengelbrock aus Borgloh bleibt. Er ist als Mitarbeiter des Vereins „Cap Anamur“ in Sierra Leone. „Es gibt keinen besseren Ort, an dem ich gerade sein könnte“, sagt der 26-Jährige.
Autorin: Anne Spielmeyer / www.noz.de
Ebola ist da. Befürchtet hatten die Menschen in Sierra Leone das seit Wochen. Ende Juli fahren Fahrzeuge der Regierung durch Freetown, die Hauptstadt Sierra Leones, und lassen durch Lautsprecher „Ebola ist da“ in alle Viertel rufen, erzählt Ole. Immer wieder nur diesen einen Satz. Am „Clocktower“, dem Kontenpunkt Freetowns, an dem normalerweise das Leben pulsiert und sich das Marktgeschrei in Motorenlärm mischt, wird es still. „Die Straßen waren wie ausgestorben. Nur vereinzelt huschten Menschen um Häuserecken“, beschreibt Ole. Seit Juni 2013 ist er als Sozialarbeiter von „Cap Anamur“ in Freetown , wo er den Menschen vor Ort „leben hilft“, wie er es nennt. „Es ist eine sehr intensive Zeit.“ Eine Zeit, in der „leben helfen“ eine neue Dimension erfährt.
Ole: „Wir sind immer zwei Schritte“ zurück
Sierra Leone ist neben Liberia, Nigeria und Guinea das vierte westafrikanische Land, in dem sich das gefährliche Ebola-Virus Bahn gebrochen hat. Nach aktuellen Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind 2240 Kranke in den vier Ländern erfasst, 1229 Menschen starben . Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Der Präsident Sierra Leones, Ernest Bai Koroma, hat längst den Notstand ausgerufen und eine Reihe von drastischen Maßnahmen angekündigt. Polizei und Militär sollen die Zentren der Epidemie unter Quarantäne stellen und dafür sorgen, dass die Ärzte sicher ihrer Arbeit nachgehen können. Ebola-Infizierte sollen gesucht und in Behandlungszentren gebracht werden, hieß es vor Wochen. Eine laute Botschaft, die in den Armenvierteln von Freetown entweder längst verhallt ist oder nur schleppend in die Tat umgesetzt wird. „Wir sind immer zwei Schritte zurück“, findet Ole. In der Regel ist das Virus vor der Prävention da. Ärger und Enttäuschung über die Autoritäten vor Ort sind ihm auch durch das Knacken in der Telefonleitung anzuhören.
Ole: „Fakten statt Emotionen“
Das Auswärtige Amt hat inzwischen alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen – Mediziner und Mitarbeiter im humanitären Bereich ausgenommen. „Ich habe eine Aufgabe“, sagt Ole nicht minder entschlossen zu bleiben. Im „Pikin Paddy“, einer Einrichtung für Straßenkinder, regelt der 26-Jährige normalerweise den Alltag, den es gerade nicht mehr gibt. Chaotischer Ausnahmezustand im ganzen Land. Die Schule bleibt wegen Ebola geschlossen. 20 Kinder kommen noch in die Einrichtung, um hier Zeit zu verbringen. Oles Tage drehen sich um Ebola, um Prävention und Aufklärung. Hundert Menschen sind zuletzt aus den Slums zu einer Info-Veranstaltung von Cap Anamur gekommen. „Das ist toll“, findet der 26-Jährige, der als Sozialarbeiter, Mediator, Koordinator vor Ort nun sieht, dass die Stille von einer Spannung abgelöst wird. „Fakten statt Emotionen“, fasst er eine wichtige Grundregel zusammen, die gilt, wenn er mit denen spricht, die gehört haben, man könne Ebola mit Salzwasser wegwaschen oder mit denen. Ole und seine einheimischen Kollegen von Cap Anamur sind selbst von Medizinern über das Virus aufgeklärt worden – teach the teacher.
„Ebola, Ebola“ statt „Weißer, Weißer“
Die Seuche wurde von Anfang an unterschätzt, sagen Experten. Wegen der Ebola-Epidemie hat Kenia bereits seine Grenzen für Reisende aus den Ländern Liberia, Sierra Leone und Guinea geschlossen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte Anfang August den „globalen Notstand“ ausgerufen. Bei einem Krisentreffen haben die Gesundheitsminister aus elf afrikanischen Staaten mit Experten und Organisationen überlegt, wie das Virus bekämpft werden kann. An fundierter Aufklärung geht kein Weg vorbei. Noch immer ranken sich viele Legenden und Gerüchte um das tödliche Virus. Statt „Weißer, Weißer“ rufen die Einheimischen „Ebola, Ebola“, wenn sie Europäer sehen, erzählt Ole – ein Ausruf im Glauben, weiße Mediziner hätten das Virus nach Westafrika geschleppt. Wem kann man vertrauen? Diese Frage bleibt. Ole hat sich sein Vertrauen in den vergangenen Monaten erspielt – auf dem Bolzplatz. Längst nennen ihn die westafrikanischen Kinder, die mit ihm kicken, nicht mehr „Weißer“, sondern „Junior Tumbu“, nach einer lebenden Fußballlegende in Sierra Leone. „Eine Ehre“, findet der 26-Jährige, der in der Jugend für den TuS Borgloh kickte, später beim VfB Lübeck, beim VfB Oldenburg und bei Eintracht Norderstedt in der Oberliga, zuletzt sogar in der 1. sierra-leonischen Liga für den FC Johansen. Die Liga ist nun unterbrochen. Wegen Ebola.
Ole: „Hier gehen alle an ihre Grenzen“
In den Kliniken des Landes spitzt sich die Situation zu. „Es ist momentan unglaublich schwer, die Isolierstationen im erforderlichen Maße auszubauen“, sagt Bernd Göken, Geschäftsführer von Cap Anamur. Der Vorsitzende des Vereins, Werner Strahl, sei momentan selbst in Freetown, um zu bewerten, wie die Arbeit im Kinderkrankenhaus sinnvoll fortgesetzt werden könne. Fast alle Kinder würden – welche Krankheit auch immer sie haben – Ebola-ähnliche Symptome wie Fieber aufweisen. Sie alle zu isolieren, sprengt die logistischen Möglichkeiten. Von zwei Ebola-Fällen hat Ole gehört, sie wurden zunächst ans staatliche Krankenhaus verwiesen. In allen vier Ländern haben sich Ärzte nach Angaben von Korrespondenten bereits infiziert. Nicht zuletzt, weil Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden. „Wenn man müde ist, passieren Fehler. Hier gehen momentan alle an ihre Grenzen“, sagt Ole. „Cap Anamur geht dahin, wo es weh tut.“
Ole: „Wir sind keine Märtyrer“
Aber wie weit geht man am Ende wirklich? „Wir sind keine Märtyrer“, betont Ole. Chlorid an den Händen und in den Gebäuden als hygienischer Selbstschutz ist Pflicht, er läuft nicht über die Ebola-Station, vermeidet enge Kontakte. „Hausbesuche machen wir nicht mehr, sondern Telefonseelsorge.“ Seine Familie Zuhause sorge sich natürlich manchmal bei den Ebola-Bildern, die über die Zeitung zum Frühstück und das Fernsehen zum Feierabend serviert werden. „Sie wissen, dass ich brenne und tragen meine Entscheidung mit.“ Ole brennt für die Entwicklungsarbeit so wie die Kerze, von der sein Großvater Willem in Borgloh ihm früher erzählt hat. Es gebe die Kerzen, die schön nebeneinander, sicher in der Packung lägen und die, die sich entzünden ließen. Ole hat sich anstecken lassen – von dem Gedanken radikaler Humanität. „Es gibt keinen Ort, an dem ich jetzt besser sein könnte.“
Der Verein „Cap Anamur“ betont, dass die, die gehen wollen, jederzeit gehen dürfen. Noch sind alle fünf Mitarbeiter in Sierra Leone geblieben. Wenn die Lage eskaliert und als zu gefährlich eingeschätzt wird, werden die Mitarbeiter abgezogen. „Kaum jemand, der drin steckt in den Armenvierteln und enge Beziehungen zu den Menschen vor Ort geknüpft hat, kann die notwendige kritische Distanz aufbauen und sagen: Komm, ich gehe jetzt“, sagt Bernd Göken, Geschäftsführer von Cap Anamur. Diese Entscheidung übernimmt der Verein.
Ole: „Pflicht des Herzens“
Ole hat Vorsprung gegenüber deutschen Helfern anderer Projekte, die erst zum Seuchen-Ausbruch gekommen sind. Ein gutes Jahr, das ihn sicher sein lässt, richtig entschieden zu haben. Landschaftlich traumhaft sei das Land, wundervoll die Menschen, gerät er inmitten der schlimmsten Ebola-Epidemie in der Geschichte Westafrikas ins Schwärmen über Sierra Leone. „Die Menschen hier können doch nichts dafür“, sagt er. Zweimal wurde ihm, dem „Weißen“ sein Handy geklaut, zweimal hätten die Kids dafür gesorgt, dass „Junior Tumbu“ es gefälligst zurückbekommt. Nur ein Beispiel, das ihn sagen lässt: „Für mich ist es eine Pflicht des Herzens, hier zu bleiben.“ Und die, die in Borgloh oder anderswo nun die Krisenmeldungen aus Freetown sorgenvoll verfolgen, die wüssten eigentlich sehr genau, dass er sein Ding mache, sagt Ole. Und dass er Dummheiten lieber lässt.