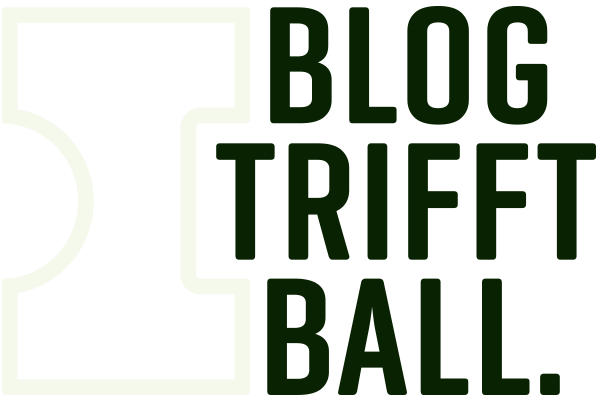Auf der fremden Tribüne
Die Abneigung gegen St. Pauli, Klischees über saufende Parkschmarotzer und die Dauer-Fehde mit Hansa Rostock, dem Herzensverein von BTB-Autor Hannes Hilbrecht, prägten sein eher negativ geprägtes Bild vom Kiezverein. Bis er experimentierte und sich langsam an den Klub heranwagte. Ein Report von der fremden Tribüne – mit deutlichem Resümee.
Eine vegetarische Bolognese – das gibt es nur bei St. Pauli. Dachte ich, als ich vor gut einem Jahr das erste Mal ganz ungeplant mit dem Kiezklub in den Nahkontakt trat. An einem Montag, zum Ferienbeginn, an meinem Debüt-Arbeitstag für BLOG-TRIFFT-BALL in Hamburg.
Kollege Semmler lud ein, schmiss mich ohne Vorahnung in die Stadionkneipe zu Rinderbouillon und Gemüse im aufgespülten Tomatenmark. Da war ich nun, als Leib & Seele Rostocker, am Millerntor. Mit allen Klischees, dezenter Abneigung und vor allem mit wenig Appetit auf grüne Idealisten-Pasta im Gepäck. Das Pauli-Emblem auf der Serviette, dazu ein wildes Gemüsepotpourri in der Soße. Und ich wollte am liebsten sofort wieder raus, in einem Zustand wild zwischen Mimose und Querulant changierend.
Es war ein Nachmittag, passenderweise ganz hanseatisch bewölkt, windig und wenig nach Juni aussehend, an dem ich dann doch beschloss, in nächster Zeit ein Pauli-Stück zu schreiben. Mich trotz der Rivalität, trotz der urgeborenen Animositäten, irgendwann dazu durchringen würde, den kleinen Großen des Hamburger Fußballs aus dem Mantel der Abneigungen zu schälen. Das Essen, trotz fleischbefreiter Tomatensoße, es hatte mir doch gefallen. Den Gesprächen der anderen lauschen, hören, dass das gleiche Fußball-Zeug gesabbelt wird wie in den gängigen Lokalitäten in Rostock. Die Lippen zum Staunen von einander getrennt, als Pauli-Manager Azzouzi grüßend durch die Reihen der speisenden Mittagsgäste schlenderte.
Heute, über ein Jahr später an einem Dienstag, ist es trüb wie damals im Juni, ähnlich wolkenverhangen rund um die britische Stadionfassade mit den geteilten Tribünen am Hamburger Dom. Nur etwas kälter und herbstlicher. Ich werde mein erstes Spiel am Millerntor besuchen. Nordderby, St. Pauli gegen Braunschweig. Viel interessanter geht es aus norddeutscher Sicht gar nicht. Wie auch, es sind die beiden einzigen Nord-Klubs im Bundesliga-Unterhaus.
Im Vergleich zu Rostock fallen mir auf dem Weg zum Stadion sofort zwei Unterschiede auf. Der eine rollt knatternd über den Boden, das Geräusch von aneinander stoßenden Glasflaschen klirrt durch die zum Stadion strömende Menge. Weniger das Bier für zwei Euro, vielmehr die zur transportierbaren Bar umfunktionierten Einkaufswagen wirken cool. Zum anderen ist es ein Flyer der Linkspartei, der von einem grauhaarigen Mann überreicht wird. „Typisch St. Pauli“, denke ich mal wieder, während meine Gedanken wieder zu kreiseln beginnen. Beides kenne ich von Hansa-Spieltagen nicht.
Ich tue mich noch immer mit der Gewissheit schwer, gleich in diesem Stadion zu sitzen. Wünsche mir sehnlichst ein 0:0. Ein lahmes Spiel, das kaum Emotionalitäten der Umstehenden verlangt. Ein Spiel, welches mich nicht als Auswärtigen, als Fremden dechiffriert. Wo man mit Händen in den Taschen einfach dasitzen kann und nicht auffällt. Die Manschetten, doch eigentlich nicht hier sein zu dürfen, sie lasten schwer auf den Schultern. Es ist ein surreales Gefühl. Irgendwie auch schade, dass man sich vor einem einfachen Fußballspiel so viele Fragen und Eventualitäten stellen muss.
Dabei verliert sich das flaue Empfinden in der Magengegend etwas, als wir noch einmal in Richtung U-Bahn Feldstraße abbiegen. Zwischen Bäcker, Kiosk und verstopfter Dönerkaschemme drängeln sich St. Pauli-Fans und gelb-blaue Löwen aneinander, doch nirgendwo ist ein Polizist in Sicht. Es ist friedlich, oft durchmischen sich braune und gelbe Trikots zu einer seltsamen Farbkombination. Dass Einzige, was dabei knallt, sind Bierkorken und aneinander scheppernde Becks’ und Astra-Flaschen.
Ich platze in eine Braunschweig-Gruppe, verwickele ein paar Gästefans in ein Gespräch. Ein St. Pauli-Anhäner im abgetragenen Sweater grüßt verwirrten Blickes die gesamte Meute. Nicht zwischen den Trikots unterscheidend, sondern jeden Einzelnen per Handschlag schätzend. Einer der Braunschweig-Anhänger, dessen Augenringe in tiefen Rillen ein halbes Leben erzählen könnten, bekennt offenherzig: „Angst? Bei St. Pauli? Nee, hier ist alles ganz entspannt. Friedlich und ungezwungen.“
Auf Rostock zum Vergleich angesprochen sagt der bereits etwas ältere Pilger: „Natürlich ist es da etwas anders als hier. Es ist aber nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt. Eher stressig. Vor allem die Eskorte vom Bahnhof direkt in den Gästebereich.“ „Gefährlich“, ergänzt ein weiterer Fan aus dem Pulk, „sei es für Braunschweiger eh nur in Bielefeld und Hannover.“
Es wird nach dieser zweiten sehr positiven Erfahrung wieder merkwürdiger, mein Magen zieht sich etwas zusammen, als sich die vermeintlichen Sitzplatzkarten in Plätze für den Stehblock auf der Gegengeraden verwandeln. Nun also doch mittendrin – nicht im kleinen Séparée der Sitzschale, sondern Schulter an Schulter aneinandergepresst.
Was, wenn die sich auf einmal zum Gruppentanz einhaken wollen?
Im Stadion selbst setzen sich die Präsentationen der kleinen Bilder fort. Der nach Reggae ausschauende Kartenkontrolleur, das Abbild eines homosexuellen Pärchens männlichen Geschlechts, das sich als Malerei auf einer Wand zum Blockeingang schmiegt, die Cannabis-Pflanze auf einer braunen Fahne, die gerade ein erstes Mal ausgepackt wird. Ein bisschen Kulisse wie auf einem Sit-In in einer gewöhnlichen Rostocker Studentenbude.
Es geht längst nicht mehr um Fußball. Das Spiel fungiert nur als Staffage des eigentlichen Erlebnisses. Es geht um Menschen. Menschen, die all das machen, was ich auch in Rostock liebe: Fußball sehen. Die eigene Mannschaft anfeuern. Hoffen und bangen, nach der nächsten Jubeltraube auf der Tribüne lechzen. Sie sind nicht anders als ich, nur in anderen Farben gekleidet.
Es ist ein Gedanke, der gefällt – „genauso wie ich“. Wie sie fluchen und meckern, die Augen aufreißen, wenn sie sich eine vielversprechende Szene versprechen.
Ich singe dabei kein einziges St. Pauli-Lied mit, habe die Hände in den Taschen meiner hellblau verwaschenen Jeans vergraben, wenn rhythmisch zum Applaus angesetzt wird. Ich raune auf beiden Seiten, wenn Tore verpasst werden. Ich bin neutral, außenstehender Beobachter einer munteren ersten Halbzeit. Ohne dem Verlangen nach Intimität zu einer Mannschaft, die nie die Meine sein wird. Die mir auch gar nicht zusteht, denn mein Herz siedet 240 Kilometer weiter nordöstlich.
Dennoch bin ich im Schein des Flutlichts so glücklich, wie ich es bisher selten war, wenn meine Mannschaft nicht gespielt hat. Es sind die Details, die an diesem Fußballnachmittag gefallen. Die hohe Quote an Frauen und jungen Menschen, augenscheinlich sind es viele Studenten. Bilder von sich umarmenden Designer-Lederjacken mit selbsterträumten Che Guevaras in löchrigen Denims. Die Haare übrigens deutlich weniger bunt als vorgestellt. Das „You‘ll never walk alone“, als um mich herum alle feiern und ich, die letzten Eindrücke verarbeitend, still vor mich her griene.
Vielleicht ist es das, was viele Fußballinteressierte so an St. Pauli fasziniert. Das Besondere, das Alternative, wie das Hells Bells aus der elterlichen Stereo-Anlage, die Musik aus alten Computerspielen und einem Musikkanon von Depeche Mode bis zur Liverpooler Fußballfolklore, einst wenig affin zum runden Leder von Richard Rogers und Richard Hammerstein geschrieben. Die Toleranz- und Willkommenskultur – auf Stadionwänden, Transparenten und Fahnen.
Für einige, für die Lederjacken und den anderen im feinen Zwirn, wirkt es phasenweise wie ein letztes „Alternativsein“ vor der nächsten Steuerklärung. Selbst Millionäre der Stadt, deren Logen beim HSV keinen Geheimnisstatus besitzen, soll man hier auf der Stehtribüne ab und an erblicken, erzählt ein Fan auf Nachfrage.
Ich selber habe mir vom Spiel nicht allzu viel gemerkt, weil es mir relativ egal war. Bekomme gerade so nochmal das Tor für mich zusammen. Dann die Szene, als ein Fan den Platz ankert und zum St. Pauli-Keeper läuft, ihn mit einer Umarmung herzt, dann schnell über den Zaun zurück ins Getümmel taucht. Gänsehaut resultierte jedoch nur aus einer Aktion, die auch nicht auf dem Rasen stattfand, sondern weit vor dem Spiel. Das berühmte Abspielen der Hymne des Gegners, der Respekt, der in dieser Geste seit Jahren mitschwingt, es berührt tatsächlich.
Hansa – St. Pauli, das Dogma des ewigen Hasses, es stört mich nun noch gewaltiger, als mich blinde Abneigung sowieso schon stört.
Hass, der zumindest in Rostock in der Wiege liegt. Onkels, Cousins, Freunde – die Antipathien finden sich überall. Bei den meisten eher in spitzen Bemerkungen, bei anderen lagen sie einmal so tief, dass Silvester-Raketen ohne Rücksicht auf Verluste in den Gästeblock geschossen wurden. Sankt Pauli-Fans, „die Zecken“, wie sie von manchen Hansa-Fans genannt werden, die mag man vermeintlich nicht in Rostock. Unabhängig von der eigenen Einstellung. Auch „linksdenkende“ Rostocker (neben einem saß ich einmal ein viertel Jahr in der Uni) lehnen die Totenkopf-Enthusiasten teilweise ab, weil sie Antipathie mit ihrer Liebe zum Klub von der Ostsee verbinden. Nicht viel anders soll es spiegelverkehrt auf St. Pauli sein, was schwer vorstellbar erscheint. Ich fühle mich nämlich willkommen. Auch, weil lange geschürte Ressentiments von zerfixten Armen, grölenden Schnapsleichen und einem eng gestaffelten Anarchisten-Kombinat längst als Nonsens überführt wurden.
Dabei gibt es auch andere Fälle, fernab der gegenseitigen Ablehnung. Von Mecklenburgern und Hansa-Fans, die in den unteren Mannschaften der Kiezkicker agieren, am Wochenende aber häufig fehlen, wenn zeitgleich die Kogge aufläuft. Ein ehemaliger Hansa-Jugendspieler, der gemeinsam mit Marco Vorbeck im FCH-Nachwuchs spielte und oft von Hamburg nach Rostock reist, um die Mannschaft anzufeuern, lief jüngst im St. Pauli-Trikot einen Halbmarathon und postete das entsprechende Bild bei Facebook – ganz ohne Shitstorm seiner Rostocker Bekannten.
Und der Edel-Fan von der Warnow, Musikstar und Hansa-Gott Marteria, formulierte es fantastisch im Werk „Hansa ist mein Leben“ von Bjoern Achenbach: „Rivalität ist okay. Ich hasse aber niemanden, nur weil er irgendwo herkommt.“
Spät abends, in einer Pizzeria, wo ich mich zur Bundesligakonferenz über meinem Bier verliere, fällt der Blick irgendwann auf die Speisekarte. „Bolognese Vegetariana“ heißt es dort in verschnörkelten Buchstaben. Die deutsche Übersetzung, kursiv dahinter geschrieben, brauche ich nicht. Mir ist aber nicht danach. Im Gegenteil. Ich hätte jetzt am liebsten Kartoffelstampf mit Bratwurst. Und eine Apfelschorle. Wie damals, im August 1999, spät sonntags nach dem 4:2-Sieg gegen Kaiserslautern im Ostseestadion. Als Timo Lange mein Lieblingsspieler wurde.
Als Wirt Massimo uns fragt, wo wir herkommen, antworte ich ganz offen „Rostock“. Dass Massimo ein St. Pauli-Trikot trägt und über den Pissoirs Sticker von St. Paulis siebter Mannschaft kleben, muss man allerdings dazu wissen. „Hansa Rostock?“, fragt er mit italienischem „Akziente“. Ich bejahe – er grinst.
„Bei uns egal, wo man herkommt. St. Pauli-Fans eine kleine Familie. Fußballfans große Familie“, italienert er, dabei glaubhaft zu erkennen gebend, neben dem Kneipier-Dasein auch als Journalist, Spielerberater und irgendeine Art von Professor zu firmieren. Er gibt einen Grappa aus, erzählt dabei so viel, dass wir das Gespräch spontan in ein Interview verwandeln.
Spätestens jetzt treffe ich für mich ein Fazit.
Irgendwann, inmitten der Fotoreise von und mit Massimo, die gerade an einer Wand zwischen Didier Deschamps und Miro Klose angekommen ist, erkenne ich für mich: Wenn Hass gegen Rivalen, nicht mit sportlicher Abneigung zu verwechseln, der Preis der „wahren“ Fan-Liebe sein soll, dann werde ich ihn nicht zahlen. Für keinen Klub der Welt.